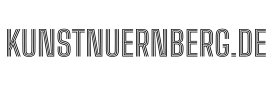Text: Dorothee Robrecht
Die international renommierte Künstlerin Jinran Kim präsentiert ihre neuesten Arbeiten in der Nürnberger Galerie KunstKontor. Ihr Markenzeichen sind extravagante Materialien wie Seife, Asche und Gaze.
Jinran Kim ist in Seoul geboren und aufgewachsen. Sie stellt international aus, ihre Werke sind in bedeutenden Sammlungen vertreten wie etwa der des MMK Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. Seit Anfang der 90er Jahre lebt sie in Berlin, reist aber regelmäßig nach Korea, um an Kunstprojekten mitzuwirken, jüngst etwa an der schillernden Medienfassade des Lotte World Tower in Seoul.
So bunt und digital arbeitet sie in Deutschland nicht. Ganz im Gegenteil: Es sind Grautöne, die ihre jetzt in Nürnberg gezeigten Arbeiten dominieren. Und die Materialien, aus denen sie bestehen, sind Asche und Gaze, wie sie auch zum Verbinden von Wunden genutzt wird.

„Weiß auf Schwarz“ ist der Titel der Ausstellung, und zu sehen sind großformatige Meerespanoramen, daneben kleinere Arbeiten mit Wasserfällen und Waldlandschaften. Keine Spur von Tieren oder Menschen – Jinran Kims Landschaften strahlen Stille aus, eine totale, fast unheimliche Stille. Von weitem gesehen wirken die Meeresbilder wie Schwarz-
Weiß-Fotografien, so realistisch schäumen die Wellen. Aus der Nähe wird sichtbar, dass es keine Bilder sind, sondern textile Skulpturen, zusammengesetzt aus Abertausenden kleiner StoDfäden.
Die Kunstfertigkeit frappiert – wie sind diese Arbeiten entstanden? „Ich habe Gaze zerrissen“, so Kim, „die man zum Verbinden von Wunden nutzt. Die Fädchen habe ich mit Asche eingefärbt und dann auf Papier genäht.“
Die Arbeit mit extravaganten Materialen wie Gaze, Asche oder Seife ist ein Markenzeichen der Künstlerin Jinran Kim. Gaze ist das Material, das ihre jüngste SchaDensperiode prägt. Für sich entdeckt habe sie Gaze, als ihre Mutter starb. Die Mutter sei lange krank gewesen und ihr Haus in Seoul immer voller Wundverbände, auch nach ihrem Tod 2015 noch.
„Ich dachte“, so Kim, „dass sich damit Bärte gut nachbilden lassen. Ich habe experimentiert und als Sujet zunächst bärtige Männer genommen, Tolstoj zum Beispiel, später aber auch Bartlose wie Rosa Luxemburg oder Samuel Beckett porträtiert.“
Einige dieser Porträts sind auch in der aktuellen Ausstellung zu sehen. Kim hat Bildhauerei in Seoul studiert und ist 1994 für ein Aufbaustudium nach Berlin gekommen. Seither lebt sie dort, und sie hat sich auch in Berlin einen Namen gemacht, nicht zuletzt dank zwei großer Einzelausstellungen auf dem Kulturforum an Potsdamer Platz.

Auch da schon hat sie mit Asche gemalt, zu Themen wie Tod und Trauma. Zu sehen etwa waren große Szenarien zerbombter Städte, darunter auch das kaputte Berlin von 1945. Und sie hat Särge montiert, aus Seifenstücken. Woher diese Vorliebe für das Düstere?
„Das hat mit meiner Geschichte zu tun, sicher auch mit der Krankheit meiner Mutter, unter der ich sehr gelitten habe. Natürlich spielt auch meine Herkunft eine Rolle. In Korea ist Krieg als Möglichkeit immer präsent. Das Apokalyptische habe ich einfach im Kopf, egal was ich mache.“
Und das gilt auch für die jetzt ausgestellten Werke. Kims Landschaftspanoramen reinszenieren eine Natur, die sie als höchst bedroht wahrnimmt – durch Menschen, die sie missachten, ausbeuten und zerstören. Kim ist überzeugt: Wenn es so weitergeht, bleibt dem Leben auf diesem Planeten nicht mehr viel Zeit.
Ihre Landschaften haben etwas Gespenstisches, doch anzusehen ist der drohende Untergang ihnen nicht. Dazu sind sie schlicht zu schön, zu perfekt. Birgt nicht eben das auch die Gefahr, eine Katastrophe zu ästhetisieren?
„Das ist eine sehr europäische Frage, die in Asien niemand stellen würde“, so Jinran Kim. „Schönheit der Darstellung ist ein Grundprinzip, unabhängig vom Inhalt. Ich ästhetisiere Katastrophen nicht, ich zeige sie. Und ich habe Gaze als Material gewählt, weil es eine metaphorische Qualität hat. Es geht darum, zu heilen.“

Die Ausstellung im Kunstkontor zeigt auch Arbeiten des Künstlers Jan Gemeinhardt, die wunderbar mit Jinram Kims Bilder harmonieren.
Ausstellung “Weiß auf Schwarz”
Galerie KunstKontor, Füll 12, 90403 Nürnberg
10. April bis 07. Juni 2025
Vernissage: Donnerstag, 10. April 2025, 18 Uhr