Das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt bewahrt eine der bedeutendsten Privatsammlungen mit Werken aus dem deutschsprachigen Raum des 19. Jahrhunderts.
Neben der weltgrößten Carl Spitzweg-Sammlung zeigt das Museum auch bedeutende Künstler wie Caspar David Friedrich und Adolph Menzel sowie viele weitere Vertreter der 19. Jahrhunderts.
Die Sammlung des Museums Georg Schäfer

Das Museum Georg Schäfer präsentiert die bedeutendste Privatsammlung der Kunst des 19. Jahrhunderts aus dem deutschsprachigen Raum. Mit Gemälden und Arbeiten auf Papier vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bietet es ein Panorama der unterschiedlichsten Kunstströmungen dieser Zeit – vom späten Rokoko, über Klassizismus und Romantik bis hin zum Impressionismus.
Die Qualität der Sammlung beruht auf hochkarätigen Einzelwerken und bedeutenden Gemälden weniger bekannter Meister. Damit steht das Museum Georg Schäfer in einer Reihe mit der Sammlung englischer Kunst in der Tate Gallery, London, oder den Sammlungen deutscher Kunst in der Nationalgalerie, Berlin, und der Neuen Pinakothek in München.

Ein Charakteristikum der Sammlung ist, dass sie umfangreiche Werkblöcke enthält, die einzelne Künstler in einem umfassenden Überblick ihrer Werkentwicklung vorstellen. Carl Spitzweg ist hier mit der weltweit größten Sammlung seiner Werke vertreten: 160 Gemälde und 110 Zeichnungen. Von Adolph Menzel besitzt die Sammlung über 100 Gemälde, Gouachen und Zeichnungen. Weitere größere Werkblöcke gibt es von Caspar David Friedrich, Georg Ferdinand Waldmüller, von Wilhelm Leibl und seinen Freunden Johann Sperl und Carl Schuch, von Hans Thoma, Josef Wenglein und Josef Wopfner sowie von Max Liebermann und Max Slevogt.
Georg Schäfer war ein enthusiastischer Gemäldesammler. Gerade deswegen erwarb er Zeichnungen und Aquarelle im Kontext der malerischen Werkkomplexe. Eine Reihe von Künstlern ist mit jeweils über zwanzig Blättern repräsentativ vertreten: Rudolf Alt, Adalbert Begas, Lovis Corinth, Joseph Führich, Otto Greiner, Peter von Hess, Wilhelm Leibl, Max Liebermann, Karl Raupp, Philipp Röth, Max Slevogt, Johann Sperl und Ludwig Vogel. Der Bestand wird in Sonderausstellungen und begleitenden Veranstaltungen dem Publikum zugänglich gemacht.
Der Sammler Georg Schäfer
Dr.-Ing. E. h. Georg Schäfer (1896–1975) trat 1919 in das väterliche Unternehmen ein. Sein Vater, der Schlosser- und Kunstschmiedemeister sowie spätere Geheimrat Georg Schäfer (1861–1925), seit 1904 mit einer eigenen Kugellager-Fertigung am Markt, hatte 1909 Friedrich Fischers Erste Automatische Gussstahlkugel-Fabrik übernommen. Im Laufe der zunehmenden Motorisierung wurde das Unternehmen mit seiner Wälzlagerproduktion zu einer rasch expandierenden Schlüsselindustrie.
1936 konnte bereits ein erstes ausländisches Zweigwerk in Wolverhampton, England, eröffnet werden. Nach der Zerstörung dieser kriegswichtigen Industrie in Schweinfurt während des Zweiten Weltkriegs und der vollständigen Demontage nach 1945 baute Georg Schäfer zusammen mit seinem Bruder Dr. h. c. Otto Schäfer (1912–2000) die Firma neu auf. In den fünfziger Jahren errichteten sie Zweigwerke in Kanada, den USA und Brasilien.
Das Unternehmen wurde so zu einem der Träger des Wirtschaftswunders dieser Jahre. Georg Schäfer wurde mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, dem Bayerischen Verdienstorden und der Ehrendoktorwürde der Technischen Universität München ausgezeichnet. Die Universitäten Erlangen, München und Würzburg beriefen ihn zum Ehrensenator. Seit 1952 war er Ehrenbürger seiner Heimatstadt Schweinfurt.

Von seinem Vater hatte Georg Schäfer Gemälde der Münchner Schule geerbt. Sie bildeten die Basis seiner eigenen Sammelleidenschaft.
Ab etwa 1950 entwickelte sich daraus die schnell wachsende und heute weltberühmte Sammlung Georg Schäfer. Sie wurde erstmals 1966 im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg der Öffentlichkeit vorgestellt. Seither waren immer wieder einzelne Aspekte oder Künstler der Sammlung in Ausstellungen zu sehen. Teile der Sammlung wurden längerfristig im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, (1977–1991), in den Städtischen Sammlungen, Schweinfurt, (1984–1999) und in der Neuen Pinakothek München (1980–2000) ausgestellt.
Georg Schäfer konzentrierte sich auf die deutsche Kunst – vor allem des 19. Jahrhunderts – zu einer Zeit, da der Kunstmarkt und die kunsthistorische Forschung diesen Bereich kaum zur Kenntnis nahmen. So gelang es ihm, eine einmalige Sammlung zusammenzutragen, die zur Neubewertung dieser Kunst seit den 1970er Jahren maßgeblich beitrug.
Die Kooperation: Stiftung, Stadt und Freistaat

Schon Georg Schäfer hatte darüber nachgedacht, ein Museum für seine Sammlung zu errichten. So entstand 1964 ein Entwurf Ludwig Mies van der Rohes. Nach dem Tod Georg Schäfers betreuten seine Erben die Sammlung weiter und ermöglichten gemeinsam mit einem wissenschaftlichen Kuratorium zahlreiche Ausstellungen. Anfang der 90er Jahre entstanden Entwürfe von Alexander von Branca zur Unterbringung der Sammlung in den historischen Gebäuden des Ebracher Hofes – gegenüber dem heutigen Museumsbau.
Dank des Einsatzes der Schweinfurter Oberbürgermeisterin Gudrun Grieser gelang es, dass der Freistaat Bayern 1996 Mittel aus Privatisierungserlösen für einen Neubau zur Verfügung stellte. Das Grundstück hinter dem neuen Rathaus, auf dem zu dieser Zeit ein Erweiterungsbau der Stadtverwaltung mit Wohnungen und Läden geplant war, erwies sich als geeignet. Daraufhin überführten die Erben den größten Teil der Sammlung in eine Stiftung, die 1997 rechtsfähig wurde und deren Bestand die Grundlage des Museums Georg Schäfer bildet.

Die Stadt Schweinfurt ist der Bauherr und Betreiber des Museums. Das Gebäude ist Eigentum des Freistaates Bayern. Da sich die Stiftung auch an den laufenden Betriebskosten beteiligt, wurden mit zwei Auktionen – bei Neumeister in München und Christie’s in Düsseldorf – eine Basis für diesen Beitrag geschaffen.
Ziel der Stiftung ist es, die Wirkungskraft und Selbständigkeit des Museums zu erhalten beziehungsweise zu stärken und die Verdienste des Sammlers nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Der Einsatz aller Beteiligten ermöglichte es, die Sammlung in einem eigenen Haus der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Zur ersten Präsentation der Sammlung des Museums Georg Schäfer

Der Besuch des MGS gibt in abwechslungsreicher Weise Einblick in die unverwechselbaren Charakteristika und die Vielfalt der Malerei des 19. Jahrhunderts. Die erste Präsentation der Sammlung zeigt circa 280 Bilder aus unterschiedlichen Schulen wie die der Münchner, Düsseldorfer, fernerhin Entwicklungen der Akademiezentren Dresden, Berlin, Wien und Kopenhagen, der Künstlervereinigungen wie die des »Lukasbundes«, der »Gruppe der Elf« sowie der Münchner und der Berliner Sezession.
Die Präsentation der ständigen Sammlung ist thematisch gewichtet und auf die Erschließung des einzelnen Werkes im Kontext ausgerichtet. Chronologische Strukturen können anhand der Schwerpunkte der Sammlung trotzdem erfasst werden: vom »Klassizismus« (Saal 9) bis zum »Impressionismus« (Saal 3). Dem Besucher bieten sich damit unterschiedliche Möglichkeiten, die Sammlung zu besichtigen.
Den Auftakt und gleichzeitig das Zentrum der obersten Ebene des MGS bilden die drei großen Säle. Saal 1 ist der deutschen Romantik gewidmet. Große Galerieformate unterschiedlichster Themen aus dem gesamten Jahrhundert sind in Saal 2 vereint. Bilder der deutschen Impressionisten mit dem Dreigestirn Lovis Corinth, Max Liebermann und Max Slevogt bestimmen den dritten großen Raum. Damit sind bedeutende Werkblöcke der Sammlung dialektisch einander gegenübergestellt.

In den um diesen Raumtrakt umlaufenden neun Kabinettsälen bietet sich dem Besucher ein ganz anderes Schritttempo und eine neue Betrachtungsweise – Ausblick in die Weite der Landschaft steht in reizvollem Wechsel der Details, die in der Nahsicht zu entdecken sind. Oberbegriffe der einzelnen Räume bilden die Kunst der Nazarener, der Spätromantiker, des deutschen und österreichischen Biedermeier, des Realismus Adolph Menzels, des Idealismus und der Salonmalerei sowie der Facetten der Kunst um 1900. Die Säle 10 – 14 sind der Entwicklung der Münchner Schule im 19. Jahrhundert, entsprechend ihrem Gewicht in der Sammlung, gewidmet. Carl Spitzweg bildet hier den Mittelpunkt; ihm ist der einzige monographische Raum vorbehalten. Nach den Münchner Historien- und Genremalern bilden hier die Gemälde Wilhelm Leibls und seines Kreises einen imposanten Abschluss des Rundganges.
Die offene Struktur der Räume im Bereich der Säle 1 – 3 erlaubt es dem Besucher, einen eigenen Weg durch die Kunst des 19. Jahrhunderts, ihre Themen und die Werke der im MGS vertretenen Künstler zu finden, der auch interessante Nachbarschaften ermöglicht – so hat man vom Saal der Romantiker aus die Malerei des Biedermeier mit im Blick.
Die Hängung nach diesen Schwerpunktthemen konzipierte das Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Sammlung Georg Schäfer, Prof. Dr. Jens Christian Jensen, der seit den 60er Jahren die Sammlung wissenschaftlich in Dokumentationen und Ausstellungen (z. B. Katalog Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 1977) begleitet hat.

Die Präsentation deutet an einigen Stellen, in den Sälen 11 und 16, Ansätze der Ausstellungsästhetik des 19. Jahrhunderts an, indem die Gemälde in zwei Reihen übereinander gehängt wurden. Eine Rekonstruktion dieser Ästhetik wird jedoch nicht angestrebt, da kardinale Gattungen der Malerei des 19. Jahrhunderts wie Kolossalgemälde und Fresken nicht Teil der Sammlung sind. Die farbige Fassung aller Räume zeigt abgestimmt auf die zeitgenössische Architektur überwiegend leicht gebrochene Farbtöne abgesehen vom dunkelroten Spitzwegraum. Dies ist eine Modifizierung der Ausstellungsgestaltung des 19. Jahrhunderts, die dunkle und farbige Wandbespannungen bevorzugte.
Der im MGS gewählte Farbklang schafft in seiner heiteren, lichtintensiven Wirkung ein ausgewogenes Verhältnis von Architektur und Kunstwerk. Den Besucher erwartet eine Atmosphäre, die Raum zum Durchatmen und zur Entspannung bietet.
Besucherinformationen
- Museum Georg Schäfer, Brückenstraße 20, 97421 Schweinfurt am Main
- Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr, Dienstag von 10.00 bis 20.00 Uhr, Montags geschlossen
- Webseite
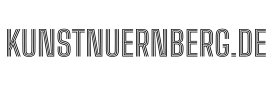


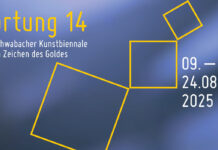


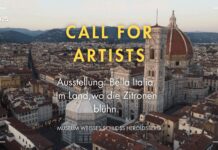

Ich freue mich schon auf die Ausstellung “Talent kennt kein Geschlecht”
und damit auf meinen ersten Besuch im Museum Schäfer.
Zumal auch Bilder von Caroline Bardua zu sehen sind.
Jürgen Bardua